Wissenschaft, insbesondere in der Medizin, verlangt ständig alles „Wissen“ zu hinterfragen, um Menschen besser helfen zu können. Über angeblich richtiges Wissen nachzudenken ist schwierig, denn es setzt Freude am eigenständigen Denken ebenso voraus, wie eine tiefe Kenntnis der Studien. Letzteres haben viel weniger Experten, als man denkt. Also hat das Bekenntnis zum Stand des Wissens einen Nachteil: Die Abhängigkeit von denen, die gelernt haben, wie man den Stand des Wissens beurteilen kann. Dazu gehört weit mehr, als nur technisches Wissen über das Studiendesign und seine Aussagefähigkeiten. In der Medizin ist es besonders kompliziert. Das merkt jeder, der einmal in einer Leitlinienkommission mitarbeitete:
Es gibt nicht für alle Fragen und alle Patienten, weder für jedes Geschlecht, noch für jedes Alter, eine belastbare Interventionsstudie. Allzu oft müssen Beobachtungsstudien, die nur Korrelationen beschreiben können, als Ersatz für gut gemachte Therapiestudien dienen. Dabei haben Beobachtungsstudien erhebliche Schwächen, vor allem bei Erkrankungen, die multifaktoriell sind. Das sind fast alle „Volkskrankheiten“, wie Diabetes, Gefäßerkrankungen, Demenz, Adipositas, Osteoporose etc. Was tun, angesichts der Ungewissheit des Wissensstandes? Man muss pragmatisch handeln und dafür geben die Leitlinien, sofern sie den Regeln der Evidenz-basierten-Medizin folgen, Hinweise.
Doch auch diese Hinweise auf den Evidenzgrad haben Schwächen. Es ist also unmöglich, Medizin ausschließlich mittels Evidenzen zu leben. Da man am Ende aber etwas braucht, auf das man sich verlassen kann, werden in Kommissionen vor Herausgabe einer Empfehlung letztlich doch Kompromisse geschlossen. So notwendig dies ist, so problematisch ist eine vielfach unbedachte Konsequenz:
Innerhalb der eine Leitlinie erstellenden Gruppe müssen nicht nur Kompromisse gefunden werden, sondern Kompromisse auch begründet werden. Und dabei spielt die Mehrheitsmeinung ebenso eine Rolle, wie der Ausgleich verschiedener Interessensgruppen. Obwohl Mehrheit und Ausgleich von Interessen und Wahrheit nichts miteinander zu tun haben.
Diejenigen, die glauben, dass Leitlinien die absolut richtige Wahrheit widerspiegeln laufen in Gefahr, zu Wissenschaftsgläubigen zu werden, obwohl gerade das Mensch Sein sich nicht in allen Facetten der Naturwissenschaft erschließt.
Aber nicht nur bei der Erstellung von Leitlinien, auch bei der Erarbeitung politischer Programme der Gesundheitspolitik, als Beispiele seinen Werbeverbote für bestimmte Speisen, und die Besteuerung gezuckerter Getränke genannt, wird im Weltbild der Wissenschaftsgläubigen die Mehrheitsmeinung zum Ersatz für beweisbare Richtigkeit. Aber Mehrheiten eignen sich nicht zum Nachweis der Richtigkeit. Zum Nachweis der Richtigkeit eignet sich nur die Überprüfung der Qualität einer Beweisführung!
Der eine, der allen anderen widerspricht und durch sein Experiment oder die Qualität seines Argumentes beweist, dass er Recht hat, ist der Wahrheit näher, als alle anderen, die einer gemeinsam geglaubten – aber überholten und falschen – Meinung sind. Dazu ein persönliches Erlebnis:
Dazu ein persönliches Erlebnis:
Ich fragte einen Mathematiker woran er forschen würde. Ich traute meinen Ohren nicht: Er arbeitete an der Frage, wieso 2 x 2 nicht immer 4 sein muss. Er erklärte mir jedoch, dass er an der „String Theorie“ arbeitet und dass seine Arbeiten und die seiner Kollegen in den USA grundlegend für neue Technologien, wie den Quantencomputer seien. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht, denn ich verstehe die String Theorie in der Mathematik nicht. Aber aus meinem „Ich traue meinen Ohren nicht“ wurde schnell ein „Offen sein für Neues“, als der Mathematiker mir von seiner Arbeit berichtete. In den letzten 15 Jahren wurde dieser Mathematiker berühmt und international geachtet. Der Mehrheitsmeinung (2 x 2=4) zu widersprechen, wird zum Erfolg für die Menschheit.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einmal über einen Satz der Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag (9.12.2020) nachzudenken: „Ich habe mich in der DDR für ein Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan. Weil ich sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht – und andere Fakten auch nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren!“ Klingt richtig. Ein Widerstand gegen eine Ideologie, die damals alle Teile der Wissenschaft durchtränkte. Doch als ich den Satz las, dachte ich erneut an den Mathematiker, der erforscht, wieso 2×2 nicht unbedingt 4 sein muss. Vielleicht ist der Satz der Bundeskanzlerin nicht klug?
Ich dachte an mich und meine Laufbahn in der Forschung. Ich hatte das Glück Kollegen zu finden, mit denen wir einen Sonderforschungsbereich der DFG auf die Beine stellten. Sein Fokus: Diabetische Spätschäden. Erlaubt waren alle Projekte, die sich mit Diabetes-assoziierten Erkrankungen beschäftigten, solange sie nur eines nicht untersuchten: Den Effekt des erhöhten Blutzuckers. Und das bei einer Erkrankung, die anhand eines erhöhten Blutzuckerwertes definiert wird?
Die Schwäche einer vereinfachend pragmatischen Denkweise wird beim Eintreten unerwarteter und neuer Situationen offenbar. Wie soll man handeln, wenn es aus der Wissenschaft noch kein allgemeingültiges Signal gibt? Als Politiker selber entscheiden, welche Experten man hinzuzieht und welche nicht?
Unter Angela Merkels Leitung (und auch nach dem Regierungswechsel) wurden in der Corona Zeit Entscheidungen getroffen, die sich auf wenige Experten, aus nur wenigen Fachgebieten stützten. Sie und ihre Mitarbeiter glaubten zu sehr an „Scientia locuta, causa finita“. Sie glaubten an einfache Zusammenhänge, wie Kontaktsperren, Hände waschen und anderes was die Gerichte noch beschäftigt, weil einfache Argumente auch logisch klingen. Sie klangen wohl so logisch, dass viele Experten nicht gehört wurden, ganze Disziplinen bei der Beratung vergessen wurden.
Wir kamen gut durch die Krise. Doch die Frage sei erlaubt: Durch welche Umstände kamen wir gut durch die Krise? Doch nicht durch die Kontaktsperren, dem Verbot den Covid-kranker Eltern beim Sterben beiwohnen zu dürfen, den Schulschließungen oder gar dem Ruf nach einer Impfpflicht? Doch nicht durch Aussagen unseres Kanzlers: „Heute, im Dezember 2021 könnte jede und jeder Erwachsene zweifach geimpft sein. Mindestens alle besonders gefährdeten Bürgerinnen und Bürger könnten geboostert sein. … Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen aufzudrücken.“
Die Fragestellung lautet: Hätten wir besser durch die Krise kommen können, wenn man stärker hinterfragt hätte, ob die einfachen Empfehlungen weniger Experten aus wenigen Fächern stimmen und die Wahrheit komplett abbilden? Hätte der Vertrauensverlust in die gesellschaftlichen Prozesse milder ausfallen können, wenn eine größere Vielfältigkeit von Meinungen akzeptabel gewesen wäre? Fazit: Durch das Vertrauen auf „Die Wissenschaft sagt uns …“ wurde Vertrauen verspielt.
Was fehlte in einer Krise durch ein Virus, das nicht so neu war, wie immer behauptet wurde? Es fehlte der Blick auf die Multikontextualität, die vielen unterschiedlichen Facetten des Mensch Seins! Es fehlte der Mut zuzugeben, dass man schwierige Situationen nicht mit einfachen und linearen Argumenten aus der Naturwissenschaft beherrschen kann! Man hätte den Mut verlangen dürfen, vor einer Entscheidung der Wissenschaft mit ihrer Kakophonie der unterschiedlichen Interpretationen zuzuhören. Dies zu machen und die verschiedenen Argumente zu sammeln, ist die Aufgabe von Behörden, wie dem Robert-Koch-Institut. Dann hätten Politiker nicht anhand des „Die Wissenschaft sagt uns …“, sondern anhand von Werten, Prinzipien, der Abwägung der Qualität von Begründungen und in Kenntnis des wirklichen Nicht-Wissens entschieden. Dadurch hätten Politiker eine höhere Verantwortung übernommen. Sie wären nur auf den ersten Blick ein höheres Risiko eingegangen. Auf den zweiten Blick wäre es gelungen, leichter sich dynamisch anzupassen und rechtzeitig Experten (wie Aerosolforscher und renommierte Pulmologen) zu hören. Dadurch hätten am Ende auch die Chance einer höheren Wertschätzung und Achtung.
Die Ebene „Wissenschaft“ ist zu schmal, der Unterschied wahr/unwahr in der Medizin zu schwer zu erkennen, um alleine basiert auf „Wissenschaft“ so große Entscheidungen, wie zu Corona-Zeit, oder heute zum Thema „gesunde Ernährung“ zu treffen. Das Christliche, zu dem sich die Pfarrerstochter Merkel bekennt, lässt auch Begründungen zu, die außerhalb der Naturwissenschaft liegen. Zu den nicht in Zahlen fassbaren Begründungen zählen Prinzipien, Werte und viele andere Aspekte der Menschlichkeit. Aspekte die nicht unbedingt physikalisch messbar sind, deren Bedeutung aber durch Worte begründbar ist.
Also gibt es einen Unterscheid zwischen Leitlinien, die das vorhandene Wissen zusammenfassen und bewerten, bei allen Schwächen, die Leitlinienkommissionen innewohnen und großen gesundheitspolitischen Entscheidungen. Bei den auf Leitlinien basierten therapeutischen Entscheidungen steht zwischen Leitlinie und dem Handeln immer noch ein in seinem Wissen, Gewissen und Erfahrung dem Patienten verantwortlicher Arzt. Bei gesundheitspolitischen Entscheidungen fehlt diese Kontrollinstanz: Ein Entschluss wird gefasst und dann umgesetzt. Keine Ärztin, kein Arzt schützt mich als Bürger vor den Entscheidungen eines Gesundheitsministers, der beispielsweise eine Impfpflicht, oder die Besteuerung von gesüßten Getränken erklärt.
Leider unterlagen sowohl in der Corona-Zeit, als auch heute noch, die komplexeren, nicht in naturwissenschaftliche Messwerte fassbaren Argumente, den einfachen Begründungen durch Modellierungen und Zahlen. Zahlen gelten schnell als Fakten. Dabei wird übersehen, dass selbst die korrekte Erstellung von Zahlen noch lange nicht bedeutet, dass die Interpretation richtig ist. Zahlen aus naturwissenschaftlicher Erkenntnis verleiten zu einer vereinfachenden Argumentation, die viele nicht naturwissenschaftliche Aspekte übersieht. Zahlen gaukeln vor, dass es einfache „top-down“ Lösungen für einen komplexen Sachverhalt gibt. Zahlen verführen dazu, eigene Dogmen, Ideologien und aktivistische Anliegen durchzusetzen. Zahlen geben eine verführerische Sicherheit, doch sie können weder die Qualität eines Argumentes sicherstellen, noch den Beweis ersetzen. Das blinde Vertrauen auf in Zahlen fassbare Ergebnisse der Wissenschaft und der feste Glaube an die Richtigkeit einer wissenschaftlichen Erkenntnis führt zu Fehlern. Ein Mittelwert mag richtig berechnet sein.
Doch was passiert, wenn mehr als die Hälfte der Probanden nicht im Mittelwert liegen? So führt das blinde Vertrauen, die Unkenntnis über das Wesen der wissenschaftlichen Aussage in der Arzt-Patienten-Situation zu einer Gefährdung des Patienten. In der gesundheitspolitischen Dimension, beispielsweise der Zuckersteuer, führt die Diskrepanz zwischen Mittelwert und Schicksal der Einzelperson, zwischen bevölkerungsbasierter Hochrechnung und tatsächlicher Wirkung auf ein Individuum, auch zu einer Spaltung der Gesellschaft.
Unbeantwortet ist die Frage am Beispiel der Zuckersteuer oder dem neuen Screenen auf Gefäßrisiken: Wie viele Menschen darf ich umsonst behandeln, wie vielen sogar durch Nebenwirkungen von Medikamenten schaden, wie viele in ihrer Privatsphäre begrenzen, um einem zu helfen? Wie belastbar muss ein Beweis sein, um viele Menschen zu zwingen, eine Maßnahme des Staates zu erdulden, wenn nicht anhand einer kontrollierten Interventionsstudie bekannt ist, ob man überhaupt einem dadurch hilft?
- Reicht dafür eine Hochrechnung aus Risiken, die nur aus Beobachtungsstudien stammen?
- Reicht dafür eine Hochrechnung und der Hinweis auf „Die Wissenschaft sagt uns …“?
- Welche Belastbarkeit benötigen errechnete Zahlen, vor allem, wenn in den Modellierungsstudien die Konfidenzintervalle sehr groß sind, um über Menschen verfügen zu können?
Andererseits gilt: Ohne Zahlen und durch präzise Messungen entstandene Ergebnisse ist unser Wohlstand ebenso undenkbar, wie der hohe Standard der Medizin. Aber: Wenn ein Teilbereich der Medizin sich verpflichtet fühlt, eine gewünschte Zahl zu produzieren, um einen Sachverhalt zu vereinfachen und griffig zu machen, verfehlt dieser Teilbereich seine Aufgabe.
Eine Wissenschaft, die immer weiter, immer genauer misst und dabei die praktisch nutzbare Grenze der Erkenntnis nicht weiter verschiebt und die Möglichkeiten, Wissenschaft zu nutzen nicht verbessert, macht sich unnötig. Das Gleichgewicht zwischen Wissenschaft als Erfüllungsgehilfe von Ideologie und Populismus und Wissenschaft als Elfenbeinturm-Disziplin, stellt sich automatisch ein, wenn man den Wissenschaftlern vertraut und ihnen die Freiheit lässt, das zu tun, was das Wesen der Wissenschaft ist: Dadurch Hoffnungsträger einer besseren Zukunft werden, dass sie nur der Frage dienen, wie man sich etwas näher an die Wahrheit annähern kann.
- Für die Nutzung der Erkenntnis sollten nicht diejenigen die Verantwortung übernehmen, die die Forschung durchführen. Sie haben nicht den Abstand zu ihren eigenen Forschungsergebnissen.
- Für die Bewertung von angeblicher Erkenntnis sollten nicht medizinische Fachgesellschaften alleine Gehör finden, denn sie sind vom Wesen her interessensgebundene Berufsverbände. Letztlich Lobbyisten.
Dafür gibt es andere Berufsgruppen, die die Ergebnisse der Wissenschaftler übernehmen damit arbeiten und sie bewerten. Deswegen gilt nicht „Scientia locuta, causa finita“.
- Der Dialog zwischen Zustimmung und Ablehnung einer Dateninterpretation beginnt erst nach der Erhebung und Interpretation von Daten!
- Die Testung der Wertigkeit und Qualität eines Beweises beginnt erst nachdem sich Wissenschaftler und die sie vertretenden Fachgesellschaften auf eine Dateninterpretation einigten.
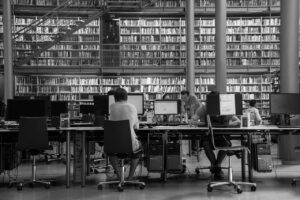 Es gibt – auch in der Medizin – eine Sehnsucht nach Beendigung des typisch politischen Vorgehens: Der Suche nach einem Kompromiss. Kompromisse wirken oft faul und unehrlich, da nicht der angeblich beste Lösungsweg beschritten wird. Doch was passiert, wenn es das absolut richtige Wissen nicht gibt und deswegen es nicht nur den einen, besten Lösungsweg gibt? Können wir mit der Unschärfe von Erkenntnis leben, mit den notwendigen Kompromissen, wenn uns eingeredet wird, wir lebten in einer „Wissensgesellschaft“?
Es gibt – auch in der Medizin – eine Sehnsucht nach Beendigung des typisch politischen Vorgehens: Der Suche nach einem Kompromiss. Kompromisse wirken oft faul und unehrlich, da nicht der angeblich beste Lösungsweg beschritten wird. Doch was passiert, wenn es das absolut richtige Wissen nicht gibt und deswegen es nicht nur den einen, besten Lösungsweg gibt? Können wir mit der Unschärfe von Erkenntnis leben, mit den notwendigen Kompromissen, wenn uns eingeredet wird, wir lebten in einer „Wissensgesellschaft“?
Statt politische Konflikte und sich widersprechende wissenschaftliche Aussagen einfach als unterschiedliche, aber verhandelbare Positionen zu begreifen, werden sie moralisch überhöht und als unverhandelbar bewertet. Die gegenteilige Aussage wird als Lüge und Fake eingestuft. Von diesen Positionen ist kein Zugang auf den politischen Gegner mehr möglich. Politik und die Auseinandersetzung um Wahrheitsfindung bei der Frage Gesundheit und Krankheit, wird durch das aktivistische Berufen auf „Die Wissenschaft sagt uns …“ letztlich zu Gunsten eines identitären Aktivismus beendet. Die Gemeinschaft wird aufgegeben, das Land gespalten.
Wäre nicht ein unter Aussprechen des Nichts-Wissens gefundener Kompromiss besser? „Scientia locuta, causa finita“ beendet die Suche nach Gemeinsamkeit und dem optimalen Lösungsweg. Angesichts der großen Aufgaben, der menschenverursachte Klimawandel ist ja nur eine von vielen, ist der Glaube an die absolute Richtigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis ein Hemmschuh kluger politischer Entscheidungen.
